Stirling-Maschinen gibt es schon viele. Die hier angestellten Überlegungen haben eine vereinfachte Form zum Ziel. Das bezieht sich auf:
- Die Herstellung: Verwendung von Low-Tech oder Standard-Bauteilen.
- Den Betrieb: Sie soll automatisch anlaufen, wenn eine ausreichende Wärmedifferenz zur Verfügung steht.
- Die Wartung: Wenig bewegliche Bauteile, wenige Lager oder Gelenke, wenige Dichtungen und reibende Flächen.
Diese Anforderungen sind notwendig, weil mein Stirling-Pendel die Überschusswärme aus einer Solaranlage nutzen soll. Damit gibt es nur eine geringe Temperaturdifferenz mit entsprechend schlechtem Wirkungsgrad. Außerdem ist die Laufzeit übers Jahr gemittelt eher gering. Wirtschaftlich sinnvoll kann es also nur sein, wenn die Kosten gering sind. Der Strom zum Betrieb soll soweit möglich mit Photovoltaik hergestellt oder vom Stirling-Pendel selbst erzeugt werden.
Was wie ein Widerspruch klingt: Photovoltaik zum Betrieb einer Solarthermie-basierten Stromerzeugung, wird sinnvoll, wenn man die Wirkungsgrade übers Jahr betrachtet: Die Sonnenenergie kann entweder mit ca. 20% Wirkungsgrad in Photovoltaikzellen in Strom, oder mit ca. 90% Wirkungsgrad in Wärme umgewandelt werden. Ziel ist eher die für Autarkie lokal genutzte, als die absolute „geerntete“ Energiemenge aufs Jahr gesehen.
Im Sommer kann der überschüssige Strom nur ins Netz eingespeist werden, die überschüssige Wärme kann zur Überbrückung von Regentagen gespeichert oder mit sehr geringem Wirkungsgrad weiter in Strom gewandelt werden.
In der Übergangszeit entsteht der Hauptnutzen der Solarthermie, die Heizungsunterstützung. Bei der Heizungsunterstützung ist Strom aus Photovoltaik aufgrund des schlechten Wirkungsgrades ungeeignet.
Im Winter reicht die eingestrahlte Sonnenenergie weder zur Deckung des Strom- noch des Wärmebedarfs.
Die Solarthermie-Anlage wird also zugunsten der Heizungsunterstützung eher überdimensioniert. Im Sommer steht damit ein Überschuss an Wärme zur Verfügung der irgendwie abgebaut werden muss. Der schlechte Wirkungsgrad stört nicht.
Grund-Ideen
- Die Arbeitskammer hat die Form eines Kreissegments (Tortenstück), der Regenerator schwingt als Pendel darin.
- Geheizt und gekühlt werden die Schnittflächen des „Tortenstücks“.
- Mehrere Arbeitskammern sind hintereinander geschaltet, um eine größere Druckdifferenz zu erreichen.
- Die Arbeitskammern füllen eine Überdruckkammer, aus der der Arbeitskolben versorgt wird.
- Die Kopplung zwischen Pendel und Arbeitskolben erfolgt elektrisch: Ein Elektromotor regt das Pendel zum Schwingen an. Davon unabhängig erzeugt der Arbeitskolben elektrische Energie. Die Druckluft wird über elektrisch gesteuerte Ventile dem Arbeitskolben zugeführt.
- Die Steuerung der Pendel-Erregung erfolgt anhand der verfügbaren Temperaturdifferenz.
- Die Steuerung des Arbeitskolbens erfolgt anhand des verfügbaren Überdrucks.
- Der Arbeitskolben könnte auch durch eine Turbine mit rotierendem Generator ersetzt werden. „Stirling-Turbine“ klingt doch cool.
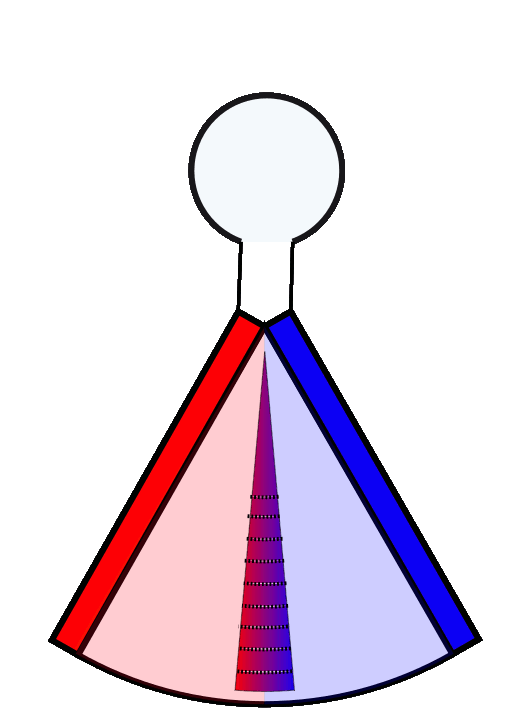
Vorteile
- Keine bewegten Dichtungen.
- Automatischer Start über Elektromotor.
- Einfacher Aufbau mit wenigen Verschleißteilen.
- Regelbare Leistung (über Druck oder Pendelfrequenz).
- Ein externer Druckspeicher kann das Pendel und den Arbeitskolben entkoppeln. Bei gleichmäßig zugeführter Energie kann eine variable Menge Energie abgenommen werden.
Theoretische Überlegungen
Als Energiequelle soll die Überschuss-Wärme einer Solaranlage genutzt werden. Daraus folgt, dass als Warmwasser ca. 80°C aus dem Speicher oder 130°C vom Dach, als Kaltwasser ca. 30°C zur Verfügung stehen werden. Das bedeutet gemäß dem Carnot-Wirkungsgrad, dass der Wirkungsgrad Nachts kleiner als (80-30)/(273+80) = 50/353 = 0,14 = 14% sein wird. Tagsüber ergibt sich (130-30)/273+130) = 100/403 = 0,24 = 24%. Das klingt erst mal nach wenig, ist aber schon die theoretische Obergrenze. Durch Reibung und Eigenverbrauch wird es noch viel weniger.
Die Energie zum Betrieb der Pumpen dürfte den Eigenverbrauch dominieren.
Nächste Schritte
Theoretische Überlegungen mit Java-Programm: https://gitlab.com/rennradler67/stirling-pendel
Prototyp-Pendel
Vermessen des Pendels
Korrektur der Theorie; Aufwandsabschätzung: welche Dimensionen müsste eine echte Anlage haben?
Aufbau und vermessen der Solaranlage: Wie viel Energie steht zur Verfügung?
Konkrete Ideen für die Umsetzung
Druck steigern für mehr Leistungsdichte.
Steigerung der Pendelfrequenz über eine Feder.
Anpassung der Pendelfrequenz über eine regelbare Feder (Änderung des Federmomentes oder der Vorspannung).
Der Auslass der Druckluft sollte auf der kalten Seite der Pendelkammer erfolgen, der Einlass vorkomprimierter Luft auf der warmen Seite.
Zur leichteren Wartung werden die Bodenplatte und die Wände nicht fest verbunden. Die Dichtung kann anfangs ein Ring aus Wasser sein.
Die Kammern schwingen synchron. Die nachgelagerten Kammern brauchen ein kleineres Volumen, weil sie schon komprimierte Luft erhalten. Dazu an der Bodenplatte Aufleger einarbeiten. Die Pendellänge muss trotzdem in allen Kammern gleich sein (bis zum Schwerpunkt), der Pendelarm muss natürlich immer bis zum Boden reichen.
Der Regenerator und das Pendel, an dem er hängt, können lose verbunden sein. Dann schlägt der Regenerator früher an und steht einen Moment am Wendepunkt still, während das Pendel noch etwas Spiel hat. Der Regenerator muss möglichst leicht sein.
Detailfragen
Die Ansteuerung der Ventile ist noch nicht geklärt. Möglich sind:
- Durch die Druckdifferenz zwischen den Kammern.
- Einfach, aber die zum Öffnen benötigte Druckdifferenz steht nicht für die Arbeit zur Verfügung.
- Mechanisch durch die Pendelposition.
- Einfach, aber evtl. nicht zum richtigen Zeitpunkt.
- Elektrisch, gesteuert durch den absoluten Druck.
- Schwierig
Sollen die Pendel und der Arbeitskolben über zwischengeschaltete Druckspeicher entkoppelt werden?
Nachteile: Die Luft im Druckspeicher kühlt aus und verliert Energie.
Vorteile: Die Pendel und der Arbeitskolben müssen nicht synchron schwingen.
Im ersten Entwurf wird voraussichtlich eine Entkopplung zwischen den Pendeln und dem Arbeitskolben benötigt, die Pendel schwingen aber synchron und ohne weitere Druckspeicher.
Geschlossenes oder offenes System? Wenn die Luft immer im Kreis wandert, kann das ganze System abgeschlossen werden. Dann gibt es keine Probleme mit Verschmutzungen. Der ganze Kreis kann mit Überdruck zur Steigerung der Leistungsdichte betrieben werden.
Wenn mit Druckspeichern zur Entkopplung von Druck-Erzeugung und Arbeitskolben gearbeitet wird, kann die Umgebungsluft als unbegrenztes Reservoir mit konstantem Druck betrachtet werden. Jeder Druckspeicher kann maximal den Druck des vorherigen Speichers + den von den Pendelstufen aufgebauten Druck erreichen. Mit Speichern ist also ein höherer Enddruck möglich, dafür ist die Leistungsabgabe nicht gleichmäßig.
Links
https://de.wikipedia.org/wiki/Stirlingmaschine
https://de.wikipedia.org/wiki/Flachplatten-Stirlingmotor
https://de.wikipedia.org/wiki/Carnot-Wirkungsgrad
 Nachts kleiner als (80-30)/(273+80) = 50/353 = 0,14 = 14% sein wird. Tagsüber ergibt sich (130-30)/273+130) = 100/403 = 0,24 = 24%. Das klingt erst mal nach wenig, ist aber schon die theoretische Obergrenze. Durch Reibung und Eigenverbrauch wird es noch viel weniger.
Nachts kleiner als (80-30)/(273+80) = 50/353 = 0,14 = 14% sein wird. Tagsüber ergibt sich (130-30)/273+130) = 100/403 = 0,24 = 24%. Das klingt erst mal nach wenig, ist aber schon die theoretische Obergrenze. Durch Reibung und Eigenverbrauch wird es noch viel weniger.